|
In Corinth macht sie
die
Bekanntschaft des Pausanias, den sie über den Verlust eines geliebten Freundes zu trösten sucht, leider umsonst. Sie tröstet sich indessen über diese Unbeständigkeit, da sie denselben Jüngling um dessen Willen sie aus Hykkara fliehen mußte. Hiermit schließt die Lebensgeschichte. Die folgenden Kapitel enthalten Schilderungen des Lebens und Treibens in jenen himmlichen Sphären. Laidioner erzählt ihrem Freunde Aristipp, an |
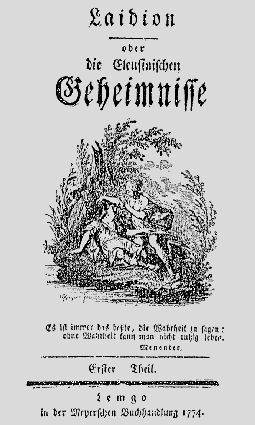
* Titel der ersten Ausgabe des "Laidion oder die eleusinischen Geheimnisse" Erster Teil, Lemgo, im Verlag
|
den ja das
ganze Buch
gerichtet ist, von den Speisen, die sie genossen, von den Bädern, die sie erfrischt von den Reden, die sie vernommen, von den Tänzen, die sie ergötzt, sogar von den Arbeiten, die sie geleistet. Zum Schluß wird die Strafe des Xenokrates mitgeteilt, der drei Monate hindurch an einem unbeschatteten Orte mit ausgebreiteten Händen auf dem Rücken liegen muß, weil er die Liebe der Phryne verschmähte. Mit diesem Kapitel schließt oder bricht vielmehr das Buch ab. * * * |